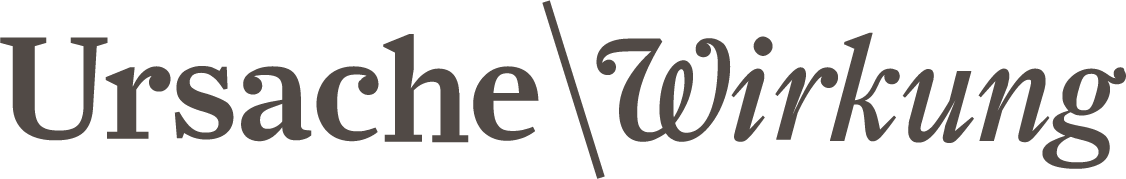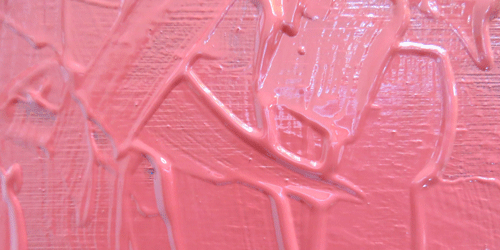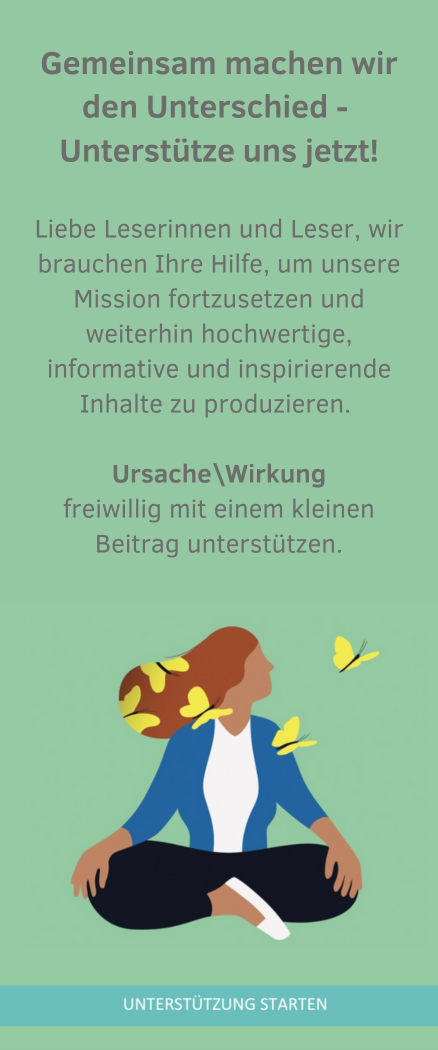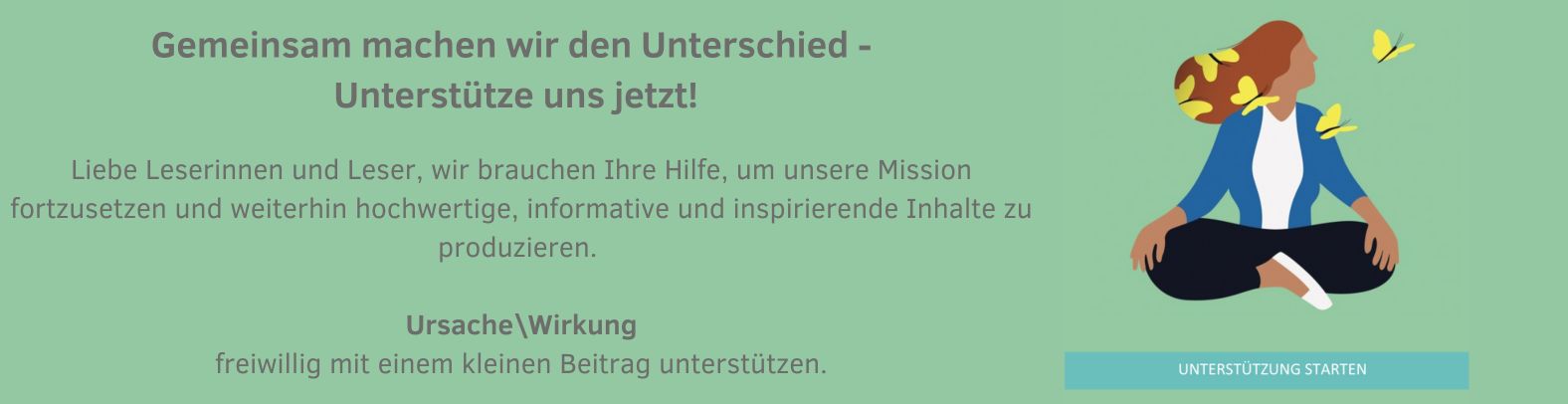Die Sinne von Lebewesen bestimmen, wie sie die Welt erleben. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken: Was sie über unsere Wirklichkeit verraten.
Wie viele Sinne haben Sie? Wenn Sie jetzt spontan ‚fünf‘ gedacht haben, dann wären Sie zu bedauern. Sie könnten dann morgens nicht aus dem Bett aufstehen, könnten sich nicht selbst anziehen und würden sich beim Waschen Gesicht und Hände verbrühen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch ordnen wir nur die altbekannten fünf Sinne – Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – unserer Wahrnehmung zu. Aber in Wirklichkeit verfügen wir über weitere, wichtige Nervenempfindungen, die uns Informationen über unsere Umwelt und auch uns selbst liefern.
Der Temperatursinn ist ein von der Schmerzwahrnehmung getrennter Reiz, der aus physiologischer Sicht sogar zwei getrennte Sinne, Kalt- und Warmrezeptoren, umfasst. In der menschlichen Handfläche findet man ein bis fünf Kaltpunkte pro Quadratzentimeter und jeweils 0,4 Warmpunkte.
Auch ohne Gleichgewichtssinn könnten wir uns nicht kontrolliert bewegen, wobei die Eigenempfindung, also die Wahrnehmung von Körperbewegung und Position unserer Extremitäten davon unter dem Begriff Propriozeption – lat. proprius ‚eigen‘ und recipere ‚aufnehmen‘ – als weiterer Sinn unterschieden wird.
Also verfügen wir mindestens über zehn Sinne. Es gibt noch weitere sensorische Fähigkeiten, die wir aber nicht bewusst wahrnehmen können, wie zum Beispiel Rezeptoren im Bereich der Kehle, über die der Blutdruck reguliert wird, so dass der Körper und insbesondere das Gehirn gleichmäßig mit Blut versorgt werden. Auch Pheromone, Botenstoffe zur Informationsübertragung, können wir zwar nicht riechen, wir reagieren aber darauf mit bestimmten Reaktionen im Bereich unseres Sexualverhaltens und empfinden dadurch unbewusst Sympathie oder Antipathie für andere.
Der Anthroposoph Rudolf Steiner postulierte in seinen Schriften sogar zwölf menschliche Sinne, die er neben den hier bereits genannten um den Erfahrungsbereich erweiterte, mit dem wir andere Menschen erleben und verstehen. Mit dem Laut- oder Sprachsinn beschrieb er unsere Fähigkeit, menschliche Gebärden und Äußerungen zu verstehen, und der Gedankensinn ermögliche es uns seiner Ansicht nach, sogar die Ideen hinter einem gesprochenen Wort nachzuvollziehen.
Beide Kompetenzen werden heute als Empathie bezeichnet, also die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Andere Lebewesen verfügen noch über weit mehr Sinneswahrnehmungen, wie zum Beispiel den Magnetsinn. Die Existenz eines solchen Sinnes im Tierreich wurde erst 1972 von der Wissenschaft anerkannt. Zuerst nur bei Vögeln, dann auch bei Fischen, Amphibien und Reptilien. Aber das dafür verantwortliche Organ blieb umstritten. Man fand zwar kleine magnetische Eisenteilchen in verschiedenen Zellen, aber keine Verbindung zu Nervenleitungen. Dennoch orientieren sich diese Tiere bei ihren Wanderungen erfolgreich daran.
Mit speziellen Zellen können Vögel wie Tauben und Rotkehlchen die Polarisation von Licht wahrnehmen. Dort, wo für uns der Himmel einheitlich blau erscheint, sehen sie entsprechende Linien und Muster, die ihnen ebenfalls helfen, über weite Strecken zu ihrem Nest zurückzufinden. Zitteraale wiederum können elektrische Felder generieren, durch die sie andere Lebewesen auch in lichtlosen Zonen des Meeres wie auf einem Radar erkennen. Die Aufzählung besonderer Sinne kann man noch lange fortsetzen: Einige Schlangenarten können mit einem eigenen Organ Infrarotstrahlung erfassen, um warmblütige Säugetiere aufzuspüren. Sie können mittels ihres Schwingungssinns auch einwandfrei ‚sehen‘, ob ihr Netz nur durch den Wind bewegt wird, ob Geschlechtspartner sich nähern oder ob die erwünschte Beute darin zappelt.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum diese Sinne so ungleich zwischen den verschiedenen Spezies verteilt sind beziehungsweise warum die Sinnesorgane so ausgestaltet sind, dass die jeweiligen Lebensformen nur einen bestimmten Ausschnitt der Welt erkennen können. Aus Sicht der Evolutionsbiologie ist jedes Lebewesen die Folge von Jahrmillionen der Anpassungen an die jeweiligen Umwelten. So auch unsere Sinne. Schon der deutsche Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe erkannte dieses Prinzip und schrieb: „Wär’ das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nie erblicken.“ Sinnesorgane entwickeln sich demnach in Auseinandersetzung mit einer bestimmten Umwelt. Und ihr Leistungsumfang ist dabei genau auf das für das Überleben notwendige Maß zugeschnitten. Wäre es für uns Menschen von Vorteil, wenn wir ein erweitertes Lichtspektrum von Infrarot bis in den ultravioletten Bereich hinein sehen könnten? Offenbar nicht. Denn diese Fülle an zum Teil für uns nutzlosen Informationen wäre eher verwirrend. Menschen können beispielsweise Licht nur zwischen 390 und 780 Nanometer Wellenlänge wahrnehmen – ein sehr kleiner Bereich des elektromagnetischen Spektrums, der sich in Anpassung an unsere Lebensbedingungen als notwendig und hilfreich erwiesen hat. Würde jedoch unser Körper in der Embryonalentwicklung zusätzliche Ressourcen für eine erweiterte Lichtwahrnehmung bereitstellen, dann müsste dieser Investition auch ein entsprechender Wettbewerbsvorteil entgegenstehen.
In Analogie dazu wäre es genauso aufwendig und sinnlos, wenn wir Geld in ein Sportauto investieren, obwohl wir nie auf einer Autobahn oder Rennstrecke fahren.
Führen wir diese Überlegungen weiter und gehen davon aus, dass unsere Sinnesleistungen nur eine über viele Generationen von Vorfahren notwendigerweise erworbene Anpassung an unsere Lebensverhältnisse darstellen. Dann folgt daraus, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen können. Wir sehen die Realität nicht, sondern nur das, was unser Nervensystem aufnimmt und unser Gehirn verarbeitet.
Die ‚reale‘ Welt enthält eine Vielzahl von weiteren Informationen, die für uns jedoch irrelevant sind und die uns nur mit Sinnesreizen überfluten würden. Daher ist es sinnvoll und überlebensnotwendig, dass wir – genauso wie andere Lebewesen – durch eine Art Filter nur die für uns wichtigen Sinnesreize wahrnehmen.
Wir sind nicht trotz unserer Unfähigkeit, die Realität in vollem Umfang zu erkennen, am Leben, sondern vielmehr wegen dieser Einschränkung. Unser Hirn hat vor allem die Aufgabe, alle einlangenden Informationen zu interpretieren und zu bewerten. Aufgrund der Physik unseres Auges müssten wir alles auf dem Kopf stehend wahrnehmen. Das Gehirn lernt in den ersten Lebenswochen die einlangenden Bilder so zu verarbeiten, dass wir die Welt ‚aufrecht‘ sehen. Setzt man Probanden eine Brille auf, die über Prismen das auf die Netzhaut fallende Licht wieder um 180 Grad umkehrt, dann braucht es nur wenige Tage, bis die Testpersonen wieder ein ‚richtiges‘ Bild der Welt vor Augen haben.
Auch bei Menschen, die taub sind und die nach Operation und Einsatz eines Hörgeräts wieder Töne wahrnehmen können, ist es ein längerer Prozess, die neuen Hörimpulse richtig zu interpretieren. Anfänglich werden die Entfernungen der Geräuschquellen nicht richtig eingeschätzt und werden Stimmen nicht richtig verstanden. Erst mit der Zeit ist das Gehirn in der Lage, aus der Fülle der Töne die relevanten herauszufiltern und zu verarbeiten.
Der Neurophysiologe John Lilly entwickelte in den 1950er-Jahren an den National Institutes of Health in den USA einen Isolationstank. Er forschte zur Frage, ob Bewusstsein äußere Stimulationen braucht oder ob das Gehirn auch ohne Reize funktioniert. Seine Versuchspersonen schwebten in völliger Dunkelheit berührungslos in körperwarmem Salzwasser. Schon nach kurzer Zeit begannen sie Lichter zu sehen und Geräusche zu hören, die ihr unterfordertes Gehirn selbst generiert hatte.
Diese Auseinandersetzung unseres Gehirns mit den zahllosen Reizen der Umgebung ist notwendig, um im Wechselspiel zwischen Körper und Geist fit zu bleiben. Wir sind keine abgeschotteten Individuen, die sich nur über ihre Existenz und ein unveränderliches Wesen definieren, sondern unser Bewusstsein entsteht sogar erst aus den Interaktionen mit den auf uns eindringenden Reizen.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.
Bild Header © Sergey Shmidt Unsplash
Bild Teaser & Klein © hpgruesen pixabay