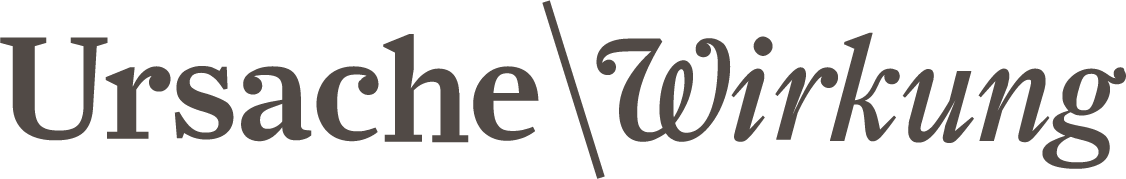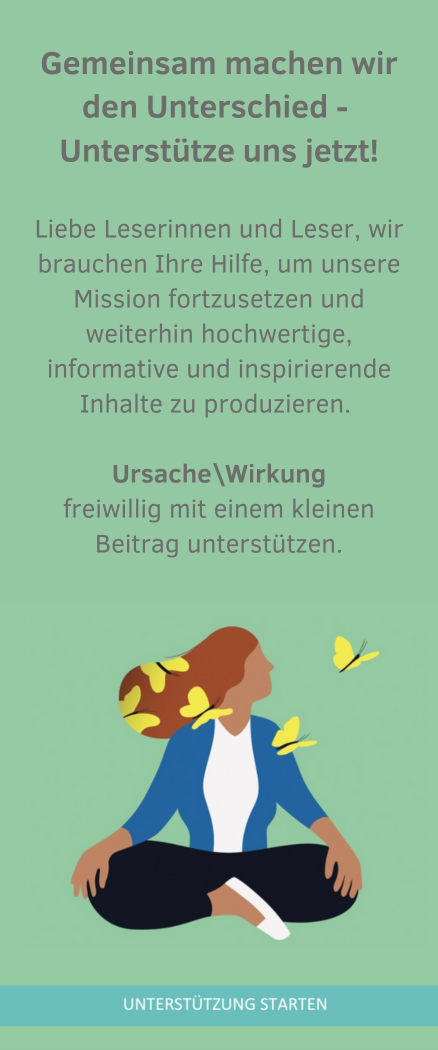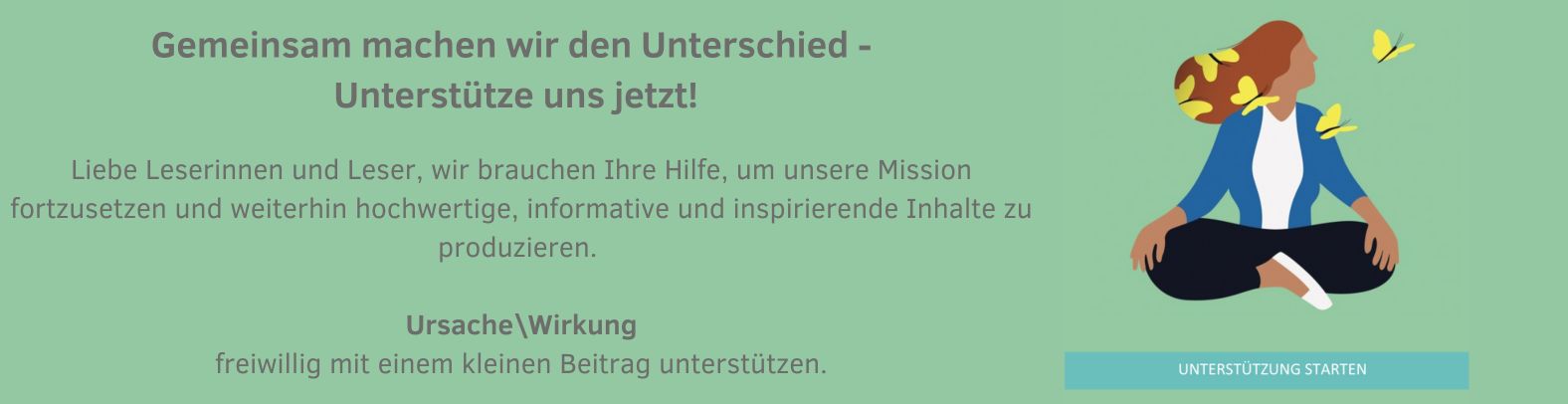Das Leiden durch Rassismus in buddhistischen Gruppen. Menschen mit nicht weißer Hautfarbe sind in westlichen Sanghas oft nicht vertreten, dabei könnte #BlackLivesMatter ein zentrales Thema im Buddhismus sein.
Die US-Amerikanerin Pamela Ayo Yetunde fordert radikales Umdenken und „kulturell kompetentes Dharma“. Stellen wir uns vor, Siddharta Gautama, der historische Buddha, wächst in einer Gated Community auf. Seine Familie will ihn beschützen vor den rauen Realitäten, die draußen vor den Mauern existieren. Vor Krankheit, Tod, Verfall, Leiden – und auch vor der Realität des Rassismus. Vielleicht hat sich die Community absichtlich abgekapselt, um sich von den Menschen draußen abzugrenzen. Siddharta verlässt jedoch diesen geschützten Raum und kommt in eine Welt, in der er Menschen sieht, die eine dunklere Haut haben als er. Er sieht unbewaffnete Menschen, die von der Polizei oder von Sicherheitskräften erschossen werden. Vielleicht sieht er auch Kranke und Unterernährte.
„Was würde Siddharta tun?“, fragt Pamela Ayo Yetunde in ihrem Gedankenexperiment. „Würde er Zuflucht im Wald suchen oder würde er in der Situation bleiben? Würde seine Antwort davon abhängen, wie er die Farbe seiner eigenen Haut in Beziehung zu denen sieht, die erschossen werden oder krank werden und sterben?“
Die Buddhistin ist Seelsorgerin und Community Dharma Leader in Kalifornien, folgt der Zen- und Insight-Meditation-Tradition und hat afroamerikanische Wurzeln. Ihr bahnbrechender Essay „Buddhism in the Age of #BlackLivesMatter“ wird seit 2016 jedes Jahr einmal auf LionsRoar veröffentlicht. Immer noch bekommt die Plattform daraufhin rassistische Zuschriften. Aber zuletzt kamen zumindest etliche positive Briefe hinzu – so viel zum Status quo von Rassismus in Nordamerika. In dem Essay fordert Yetunde ein radikales Update des traditionellen Narrativs über Buddhas Leben. Siddharta, der Sohn einer wohlhabenden Adelsfamilie, der aus der reichen Welt ausbricht, um die Wahrheit über das Leiden in dieser Welt zu erkennen – für die meisten Afroamerikaner, so Yetunde, ist dieses Problem sehr weit weg. „Wenn wir Buddhas Geschichte weiter so erzählen, wie wir sie immer erzählt haben, wird sie für das Leiden von so vielen Menschen irrelevant bleiben.“ Die Meditationslehrerin fordert „kulturell kompetentes Dharma“, in dem jede Form des Leidens Platz haben muss. Vor allem auch das Leiden, das durch Rassismus entsteht. Doch genau dafür ist in vielen Sanghas im Westen kein Platz.

Rassismus äußert sich auf viele Arten. Da sind die offenen Beschimpfungen, Übergriffe und Attacken, es gibt aber auch subtilere Formen, die sich über Generationen in eine Welt, in der das Weiß-Sein als Norm gilt, eingebrannt haben, in Gestik, Denken und Sein – auch wenn die Menschen im Westen die besten Intentionen haben, wie Gina Sharpe, Gründerin der Insight Meditation Center in New York, sagt. Egal, ob wir es wollen oder nicht: Auch westliche Dharma-Zentren sind vor Rassismus nicht gefeit.
Der Buddhismus im Westen ist oft ein elitäres Unterfangen. „BabyBoomerBuddhismus“ nannte LionsRoar-Chefredakteur Melvin McLeod den Buddhismus, der sich vor allem ab den 1970er-Jahren im Westen verbreitete: „Es war ein Buddhismus für privilegierte Menschen, hauptsächlich für Weiße aus der Mittelschicht, für Akademiker und nicht für Menschen, die etwa Ungerechtigkeit, Finanzdruck oder Trauma erlitten haben“, erklärt er. „Ich bin der einzige schwarze Mönch, den ich in drei Jahren getroffen habe“, schreibt der US-Amerikaner Bhante Panna, der in Thailand und Vietnam lebt. Und auch Lama Rod Owens fasst in seinem Buch „Love and Rage“ zusammen: „Der erste schwarze Lehrer, den ich je getroffen habe, war ich selbst.“ Buddhismus im Westen, attestiert Yetunde, ist heute fast gleich gesetzt mit „Weißem Buddhismus“. Diese Art der Verbreitung führte wiederum dazu, dass gewissen Formen des Leidens in den buddhistischen Interpretationen kein Platz eingeräumt wurde.
Yetunde berichtet von den Schwierigkeiten, das Thema in die Sanghas zu bringen. „Es gab so viel Widerstand dagegen, auch nur darüber zu sprechen“, berichtet sie von Erfahrungen in Kalifornien und Atlanta. Es hieß dann: „Bitte nicht hier. Das zerstört den Frieden, für den wir doch hergekommen sind, nämlich zu meditieren.“ Mal wird man zum Schweigen gebracht, manchmal beschuldigt. Viele hätten dann auch wieder den Sangha verlassen, weil er sich nicht als sicherer Ort herausgestellt hat. „Wir können über jede Art von Gründen für Leiden sprechen, aber nicht über den Grund für das Leiden durch Rassismus“, merkte Yetunde.
Seit der brutalen Ermordung von George Floyd im Mai 2020 hat sich einiges geändert. Am 25. Mai starb der zweifache Familienvater, weil ein Polizist ihm neun Minuten lang die Kehle zudrückte. Floyds vermeintliches Verbrechen: Er wollte – so der Vorwurf – mit einem falschen 20-Dollar-Schein Zigaretten kaufen. Der Tod von Floyd löste weltweit Empörung aus. BlackLivesMatter (BLM) richtete die internationale Aufmerksamkeit darauf, dass in den USA eine weitere Generation aufwächst, die mit polizeilichen Übergriffen rechnen muss. BLM wurde zu einer internationalen Protestbewegung, von der auch die buddhistische Welt nicht unberührt blieb.
„Seit einiger Zeit gibt es eine Trendwende in der Fähigkeit der Menschen, über Rassismus in der Sangha zu sprechen“, beobachtet Yetunde. Dahinter steht der beschwerliche, hartnäckige, jahrelange Kampf von Menschen wie Yetunde und vielen ihrer Dharmakollegen und -kolleginnen dafür, dass ihre Stimmen und ihre persönlichen Formen des Leidens gehört werden. Ende 2018 trafen sich in New York erstmals buddhistische Lehrer afroamerikanischer Herkunft zu einer Konferenz. Mittlerweile gibt es Podcasts, die sich dem Thema widmen. Im Dezember erscheint das von Yetunde editierte Buch „Black & Buddhist“. Unter dem Schlagwort „Black Sanghas“ finden sich heutzutage in den USA etliche Dharma-Gruppen. Thich Nath Han etwa hat Retreats für People of Colour organisiert.
Anfangs war Yetunde davon nicht ganz überzeugt. Doch nach den rassistischen Erfahrungen in von Weißen dominierten Sanghas erlebte sie in der „freiwilligen Trennung“ eine Befreiung ungeahnten Ausmaßes. Meditationslehrerin Ruth King formuliert das so: „Der Dharma ist tiefer als viele der buddhistischen Institutionen, in denen wir uns finden.“
Es ist die buddhistische Lehre, die Yetunde hilft, mit den rassistischen Erfahrungen besser umzugehen. Sie empfindet oft Wut, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit über den Status der Rasse in dieser Welt. Die Praxis der Achtsamkeit und das Meditieren helfen, mit diesen Gefühlen umzugehen: „Schau dir ganz genau an, was passiert. Und dann probiere, eine passende Antwort zu geben.“ Sie denkt etwa an ein altes Sutra, in dem Buddha gelehrt hat: Sogar wenn gerade deine Gliedmaßen abgetrennt werden, sag deinem Angreifer etwas Positives. „Das wird dabei helfen, von Gewalt abzusehen.“

Egal ob aus Naivität oder aus Boshaftigkeit, schreibt Mönch Bhante Panna, „es wird mich nie darin aufhalten, eine gute Person zu sein. Die Aktionen und die Ignoranz anderer Leute sind ihre Fehler, ihr Karma. Aber die Art, wie ich antworte, ist mein Karma.“ Yetunde wendet die Vier Edlen Wahrheiten des Buddha auch auf Rassismus an: „So wie Siddharta erkannt hat, dass es keine Erlösung vom Leiden im Samsara gibt, so ist es auch mit dem Rassismus: Es gibt keine absolute Sicherheit. Nur relative Momente der Schmerzlosigkeit.“
Yetude will Buddhas Leben so erzählen, dass es viele Menschen mehr einbezieht. Ein „kulturell kompetenter Dharma“ könne etwa den Weg der gemeinsamen Befreiung hervorkehren. Oder: „Was, wenn wir betonen würden, dass Buddha selbst eine Person of Colour war?“, schlägt sie vor, anstatt Buddha oder Jesus weißzuwaschen. Vielleicht ist der Aspekt von Siddhartas Leben, dass er aus dem wohlhabenden Elternhaus wegging, nicht so relevant für ein nicht weißes Publikum. Sehr wohl aber der Aspekt, dass Eltern ihre Kinder beschützen wollen, so wie viele Parents of Colour, die mit sich ringen, wenn sie ihren Kindern von der Realität draußen, von der Realität des Rassismus erzählen sollen. Sie wollen einerseits die positive Unbefangenheit ihrer Kinder nicht zu kaputt machen, doch irgendwann müssen sie das Gespräch mit ihnen suchen, damit sie sich „richtig“ verhalten, wenn sie etwa mit einem weißen Polizisten in Kontakt kommen.
Die offenen und subtilen Normen, die sich um die Diskriminierung der Hautfarbe ranken, sind über Jahrhunderte gewachsene, rassistische Konstrukte, die zumeist gar nicht bewusst wirken. Diese zu demontieren, ist eine Aufgabe, der sich alle Menschen stellen sollten. Gerade praktizierenden Buddhisten ist das nicht fremd, besteht das Ziel ihres Trainings doch darin, sich von allen falschen Konstruktionen zu lösen und zu befreien. Erreicht werden kann das unter anderem, indem das Leiden, das in dieser Welt herrscht, erkannt wird.
Welche Form dieses Leiden hat, ist sehr individuell. Ziel der buddhistischen Gemeinschaft sollte es daher sein, sich gegenseitig beim Erkennen des Leidens nicht im Weg zu stehen, sich nicht den Blick darauf zu versperren, sondern Teil der Befreiung des anderen zu sein.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 114: „Balance finden"
Yetundes neues Buch ist George Floyd gewidmet, dem die Kehle zugedrückt wurde, bis ihm der Atem ausging. „Wenn wir uns nicht wehren“, schreiben sie und Co-Herausgeberin Cheryl A. Giles im Vorwort, „dann lassen wir uns selbst unabsichtlich zum Schweigen bringen. Weil wir zu große Angst davor haben, das größte Geschenk, das wir haben, einzufordern und zu ehren: unseren Atem. Aber als schwarze praktizierende Buddhisten kennen wir doch unseren Atem so gut vom Achtsamkeitstraining. Zu Ehren von George Floyd und unzähligen anderen geloben wir zu atmen. Wir atmen zum Wohle aller fühlenden Lebewesen.“
In der Printversion dieses Artikels, wurde der Begriff "farbig" benutzt. Nach Hinweisen von unseren treuen Lesern, haben wir uns dazu entschieden, diesen in der Onlineversion durch "People of Colour" auszutauschen.
Dr. Anna Sawerthal ist Tibetologin und Journalistin. Sie studierte in Wien, Nepal, Lhasa und Heidelberg. Sie lebt in Wien.
Einen weiteren Artikel zu diesem Thema, von der amerikanischen Aktivistin Kaitlyn Hatch, finden Sie hier.
Bild Header & Teaser © Pixabay